Zur Typografie und ihren Ursprüngen
Kommentar des Editor-in-Chief | Johannes Frederik Christensen
The Business of Brand Management beleuchtet Markenführung im Kontext von Gegenwart und Geschichte. Dieser Beitrag ist Teil einer Reihe von Wiederveröffentlichungen ausgewählter Texte von Olaf Leu und Bodo Rieger aus den Jahren 1987 bis 2018. Was damals gedacht, geschrieben und vertreten wurde, lohnt die erneute Lektüre – nicht aus Nostalgie, sondern weil sich darin Fragen spiegeln, die auch heute nicht gelöst sind.
Hanna Kölbl (Fachhochschule Würzburg): Herr Professor Leu, Sie sind das erste Deutsche Mitglied des Type Directors Club of New York. Wie kam es dazu, dass der TDC NY eine deutsche Liaison eröffnete und wann war das ?
Zum Ersten: Ich bin nur das zweite deutsche Mitglied, vor mir war Hermann Zapf. Und zu Ihrer zweiten Frage: Letztlich war es das 1961 in New York gegründete ICTA (International Center For The Typographic Arts), das internationale Bestrebungen verfolgte, und zwar weltweit, also auch den Austausch von Informationen der grafischen Künste.
Als ich 1964 zum ersten Mal in den USA, speziell in New York, war, erkannte ich die Chance, amerikanisches Design über den Nordatlantik zu schaffen. Das ICTA fungierte immer als Veranstalter. Auch der Type Directors Club war bis 1983 unter den Fittichen des ICTA – erst als das ICTA erlosch, konnte man von einer Sektion Deutschland des TDC reden, und ich war dann bis 1990 dessen Chairman. Ein kleines Team hatte lediglich die Aufgabe, die Type Directors Show an geeignete Partner zu vermitteln. Es war mehr eine konsularische Aufgabe – eine eigene, aktive Vereinsarbeit war von New York nicht erwünscht.
Abschließend zusammengefasst: Der TDC bzw. dessen Jahresausstellung wurde ab 1965 bis 1983 durch das ICTA-Netzwerk gefördert, war dann ab 1984 selbstständig als Standortvertretung, und das bis in die heutigen Tage.
Welchen Stellenwert in der Gestaltungsbranche und vor allem in der typografischen hatte der TDC zu seinen Gründungszeiten und welchen hat er heute?
Das alles hat oder hatte mit der Ostküsten-Situation zu tun. Seit 1920 gab es hier den Art Directors Club of New York, der, nachdem der Wettbewerb stattgefunden hatte, ein eigenes Jahrbuch herausbrachte. Und darüber hinaus war es chic, sich zum Lunch mit Kollegen im clubeigenen Restaurant zu treffen. Das war die Kontaktbörse schlechthin. Was leider nicht stattfand, das waren empirische Gedanken. Vielmehr war der ADC of NY mehr ein gesellschaftliches Miteinander, kein Platz für Experimente, neue Welten, neue Möglichkeiten. In diese Lücke stieß dann der Type Directors Club of New York, der 1946 aktiv wurde, und zwar insbesondere in der Education. Dessen Jahresausstellung, sprich der Wettbewerb, wurde ja erst 1955 gegründet – alle Welt macht den TDC fast nur an dieser Ausstellung fest, weiß aber nicht, dass der Club sehr lokal, sehr auf New York bezogen ist und so etwas bietet, was man als ein aktives Clubleben nennt. Deshalb ist auch eine Mitgliedschaft außerhalb von New York reiner Nonsens. Denn am eigentlichen Clubleben, an den Veranstaltungen und Vorträgen etc. kann man ja als deutsches Mitglied nicht teilnehmen – aber genau das macht den eigentlichen Club aus! Die TDC-Mitgliedschaft außerhalb von New York ist nach erfolgter Anmeldung eine Unterschrift – reiner Bluff also. Aber die Bezeichnung TDC member macht sich eben gut auf Briefbögen und Visitenkarten.
In den Gründerzeiten, das zeigen vor allem die Kataloge der Wettbewerbsergebnisse von 1955 bis 1979, kann man den empirischen Gedanken bis zum Ende der Siebzigerjahre verfolgen. Danach wird es breiig. Die einstmals klare, stringente, analytische und logische Lösung zerfällt, löst sich auf.
Heute ist der TDC sehr populär, das bezieht sich aber nur auf die jährlich gezeigte Show, und die ist immer für eine typografische Überraschung gut. Und außerdem: Das Jahrbuch wie auch die Ausstellung ist eine cooper mine – eine Klau- und Anregungsbörse. Gut geklaut ist allemal einfacher als selbstgemacht!
Wenn der TDC Einfluss auf die Entwicklung des Designs hatte, woran ist das zu erkennen, oder woran würden Sie das festmachen – in welchen Jahren ist das besonders zu erkennen? Wie veränderte sich der Einfluss, evtl. in der letzten Zeit?
Vor allem in den Fünfziger- und Sechzigerjahren war der Einfluss des TDC enorm. Denn jetzt sprach man plötzlich von der Neuen Amerikanischen Schule, deren oberster Protagonist Herb Lubalin war. Die Lubalin´schen Lösungen mittels Schrift sind zu typografischen Ikonen geworden. Allein eine Schrift wie die Avantgarde machte Schule, die Verschachtelungen von Buchstaben, Ziffern, Zeichen wurden zur Mode. Leider wurde dabei auch viel Mist erzeugt, denn die Avantgarde ist nur in einem Schnitt, dem Originalschnitt, wirklich gut. Architekten und Designstudenten lieben diese Schrift, aber in Hairline, geradezu grauselig.
Aber auch mein geliebter Herbie (Herb Lubalin) machte Fehler, indem er seinem Originalschnitt weitere hinzufügte, darunter Kleinbuchstaben – das alles kann man in der Pfeife rauchen. Der Einfluss hat, etwa ab den Neunzigerjahren, deutlich abgenommen. Das hing auch mit den vielen Publikationen zusammen, die jetzt plötzlich auf den Markt strömten. Die einst sprudelnde, klare Quelle, der TDC, war stark vermischt mit äußeren Einflüssen. Das ergab am Ende dann keinen reinen Kentucky-Whisky aus USA, sondern ein Gemisch mit Kirsch-, Apfel-, Pfirsich-, Banane- und Pflaumenschnaps. Im Prinzip hätte man von Anfang an den Deckel draufhalten müssen und nur Arbeiten made in USA annehmen dürfen – aber da gab es Leute wie Olaf Leu, der wollte Awards from the USA – und schon war die Quelle mit Schwarzwälder Kirsch versetzt ...
Und daran anschließend: Hat der TDC die Rolle der typografischen Darstellung dann eher beeinflusst oder doch eher gelenkt und womit?
Von einer strategischen, dogmatischen Lenkung durch den TDC kann man nicht sprechen – ein Dogma liegt generell nicht in der Struktur der Amerikaner. Ganz im Gegenteil hierzulande, z.B. die Ulmer Schule. Das waren Sheriffs. Wer nicht an sie glaubte, wurde sofort erschossen. Wenn es einen Einfluss gab, ja, dann durch das Gesehene, das Mögliche in einer Type Directors Show.
Einige aufeinander folgende Jahrgänge unterscheiden sich in ihren Stilrichtungen starkvoneinander. Inwieweit, glauben Sie, liegt das an der jährlichen Neubesetzung der Jury?
Eine geradezu schmerzhafte, aber grundsätzliche Frage. Es gibt zwei Systeme: Einmal das einer Dauerjury. Diese zeichnet sich durch stetig erweitertes, wachsendes Wissen der Juroren um die vorgelegte Materie aus. An sich ist das die Idealform, wenn es darum geht, Jahre und ihre Ergebnisse zu analysieren. Ich habe einer solchen Idealjury 18 Jahre lang angehört. Wir erkannten in jedem Jahr die Dubletten vom letzten Jahr und lachten uns schief über so viel Unvermögen.Jetzt kommt das zweite System, das einer immer neu zusammengesetzten Jurymannschaft. Es ist der verständliche Wunsch, auch einmal Juror zu sein, über Andere zu richten. Sehr, sehrmenschlich. Nach dem Motto, was der kann, kann ich auch.
Natürlich erkennen neue Leute die Dubletten von vorvergangenen Jahren nicht, weil siediesen Speicher der Erinnerung von schon Dagewesenem nicht haben. Aber es macht sich natürlich prächtig, auf den ersten Seiten eines Jahrbuchs als Juror vorgestellt zu werden. Sieh´ mal an, wie bedeutend ich bin ...
Wahrscheinlich wäre die beste Form: zwei Drittel Dauerjury, ein Drittel neue Juroren.
Der Jurymarkt ist einer der Eitelkeiten. Jeder FIFA-Schiedsrichter im Fußball muss 300 Regeln kennen und beherrschen, nur die Designerlein glauben, das kurz und schnell aus der Hüfte heraus zu beherrschen.
Wie haben der Funktionalismus (form follows function – Louis Sullivan) und das Styling die Entwicklung des europäischen und die des amerikanischen Designs beeinflusst?
Die USA erlebten von 1880 an, insbesondere nach 1915, gewaltige Einwanderungswellen, darunter so manches europäische Genie in Architektur, Industrial Design und Graphik. Wer weiß denn schon, dass Cassandre, der als DER französische Plakatgestalter gilt, einige Jahre in den USA verbrachte, dort arbeitete und wesentliche Anstöße der grafischen Gestaltung vermittelte. Es waren die Russen, die ganz wesentlich der Magazingestaltung ihren Blütenkranz aufsetzten. Die USA waren ein Talente-Pool von ungeheurem Einfluss auf ihre gesamte Umgebung. Die ersten Stromlinien-Autos und Lokomotiven kamen aus den USA – abgesehen von den hoch aufstrebenden Glaspalästen in Chicago und New York. Die USA lebten geradezu von den Begabungen der Einwanderer. Es waren also vorwiegend Europäer aus aller Herren Länder, die Amerika zum großen Vorbild für das Styling machten und dabei auch Alltagsgegenstände wie eine Küchenmaschine nicht ausließen.
Die Europäer verfügten über das theoretische Wissen, die Umsetzung aber geschah in den USA. Insofern beeinflusste das amerikanische Design mehr und mehr Europa, das in diesen prägenden Zeiten allerdings noch in zwei Weltkriege verwickelt war. Die USA wurden und waren ein Treibhaus des Designs.
Inwiefern hat der europäische Funktionalismus das Amerikanische Design beeinflusst?
Nun gut, der Futurismus stammt aus Italien, fand dort auch in der Architektur seine Anwendung. Italien war sich immer seines gestalterischen Einflusses bewusst, in der Mode, in der Farbgestaltung, im Industrial Design von Gebrauchsgegenständen. Das Graphic Design war in Italien wie auch in Frankreich ein Stiefkind, was Modernität anbelangte. Frankreich brachte hervorragende Nur-Plakatgestalter hervor, England war führend im Verlagswesen, Deutschland war einerseits ein Plakatland, aber auch die Gebrauchsdrucksachen verrieten einen gestalterischen Aufbruch, der um 1925 stattfand und weit in unsere Zeit hineinstrahlt. Ohne die Erkenntnisse dieser Zwanzigerjahre- Bewegung wäre das heutige Graphic Design nicht denkbar. Die Katastrophe letztendlich war dann der 2. Weltkrieg, der alle fortschrittlichen Gedanken tötete und die Auswanderung, ja, die Flucht hervorragender Talente in die USA auslöste. Die USA profitierten glänzend davon.
Herrscht in Europa eine größere Ablehnung des Historismus als in den USA, und wenn ja, woher kommt das?
Nun, der Historismus war Ausdruck der gekrönten Häupter. Sie ließen sich ihre Paläste in verschiedenen Stilen bauen, freuten sich an Neo-Renaissance, Barock, Klassizismus. Die wohl situierten Bürger taten es ihnen nach. Auch sie wollten protzen, insofern der gewaltige Wirtschaftsboom nach 1875 ungeahnte Ressourcen freigab. Plötzlich war Geld vorhanden, man investierte.
Die USA dagegen lebten von ihren vormals armen Einwanderern, die nach und nach zu Geld kamen, aber nun nicht unbedingt das nachbauten, was sie aus ihrer Heimat kannten. Insofern hatte der Historismus in den USA nie eine Chance. Gefragt waren moderne Bauten à la Mies van der Rohe oder Gropius.
Was würden Sie als die Gute Form beschreiben? Und stimmt es, dass der Wunsch danach in Europa scheinbar größer ist als in den USA?
Die Gute Form war einst, vor allen Dingen in den Zwanzigern, das Bestreben von Designern, den Menschen, letztlich dem Publikum, in allen Anwendungsbereichen zu mehr Geschmack zu verhelfen. Sie quasi zu erziehen. Das gelang allerdings nur in verschiedenen Anwendungssegmenten wie Textil, Glas, Keramik oder Metall. Die Frankfurter Küche ist so ein Beispiel. Hier kümmerte man sich um den einfachen Bürger, er sollte besser leben. Überhaupt war der missionarische Eifer der Designer damals grenzenlos. Man wollte den Mitmenschen nun endlich klar machen, dass zum besseren Leben das bessere, das gute Design gehört. All diese Erziehungsmaßnahmen, wie ich sie nenne, konnten nur Teilerfolge erzielen. Denn Gute Form, sprich gutes, oft aufwendiges Design, kostet eben etwas mehr, und mancher mag sich das auch nicht leisten.
Inzwischen ist die Gute Form – sowohl das Bedürfnis danach wie auch ihre Ablehnung oder Ignoranz – global geworden. Zwar spielt Italien in der Mode, im Textildesign der im Möbeldesign eine führende Rolle, auch Skandinavien glänzt in Glas und Möbeldesign, dafür hat Good Old Germany Audi und BMW. Würde man einen Ausländer fragen, was ihm zu Deutschland einfällt, dann käme garantiert nicht das außerordentliche Graphic Design, sondern Mercedes und BMW. Wir sind die Autobauer Nr.1. Vorsprung durch Technik, und nicht Vorsprung durch Design, was wir gerne hätten.
Führt das heutige gestalterische Werkzeug, der Computer, zu einer größeren Monotonie als es die früheren gestalterischen Werkzeuge taten oder sind wir durch das World Wide Web und die Massenmedien einer visuellen Überflutung ausgesetzt und dadurch weniger sensibel geworden?
Das ist eine Frage, die Sie einem demnächst Achtzigjährigen stellen. Insofern ist sie unfair, denn ich werde nicht überflutet, denn ich bin weder in den sogenannten Sozialen Netzwerken aktiv noch habe ich einen Auftritt im Web, es interessiert mich einfach nicht (mehr). Aber ich verkenne nicht, dass dies Probleme meiner Kinder (4), Enkel (10) und Urenkel (3) sind und sein werden.
Bekanntlich gibt es ja viele Meinungen zum Unterschied zwischen Kunst und Design. Wie ist Ihre persönliche Meinung dazu?
Nun, das ist doch sehr einfach, oder ich mache es mir einfach. Designer lösen die Probleme anderer – mit ihrem Design und bezogen auf einen Auftrag, der ihnen erteilt wurde. Künstler kennen den Anderen nicht und haben im Normalfall auch keinen Auftraggeber; sie machen das, wozu sie gerade Lust haben. Zum Beispiel Blaue Wälder, die keiner kauft. Erst mit einem gehörigen zeitlichen Abstand – und den muss man als Künstler aushalten – spricht es sich herum, dass Blaue Wälder der Hit sind. Und endlich treibt eine Galerie – immer mit der Hälfte am Erlös beteiligt (!) – die Preise hoch. Je höher, umso größer der Anteil. Kunst kommt von Können. Dieses Sprichwort wird allerdings zunehmend missbraucht, weil es dem Kunstmarketing nicht in den Kram, nicht in ihre Argumentation passt. Aber letzten Endes versuchen beide Branchen, Kunst und Design, vom Können zu leben. So einfach ist das doch am Ende.
Wann hat sich die Bezeichnung des Gestalters in Designer verwandelt, und welche Konsequenzen brachte das mit sich bzw. wie hat sich das Berufsbild dadurch verändert?
Nun, die Gestalter – in der Schweiz ist das übrigens eine ehrenvolle Berufsbezeichnung – hatten schon immer Sinn fürs Theater, für Verkleidungen, Vertausch der Rollen. Mit der Zeit gehen, aber eigentlich immer dasselbe machen. Ein neues Etikett. Ist doch ganz schön anzuschauen. Außerdem die Technik. Die Software. Die Hardware. Man tippt heute mit dem Finger, Abteilung wisch & weg. Als Gestalter hatten wir früher eine Schere, eine Rasierklinge, eine Pinzette, ein Lineal und Fixogum, das war lösbarer Klebstoff. Und natürlich einen Untergrund, weißer Karton 800 g/qm.
Heute glotzt man auf eine beleuchtete Scheibe, daneben liegen – mit Post-its versehen – die neuesten Vorlagenbücher, die Jahrbücher des ADC of NY, des TDC of NY, dazu einige englische und amerikanische Szenemagazine. Und ewig grüßt das Murmeltier ...
Wie hat sich durch das neue Berufsbild des Designers seine Denkweise und Einstellung verändert?
Das neue Berufsbild ist mir total fremd. Bislang war immer das, was hinterher herauskommt, Maßstab für das, was entweder mit original, originell, mittelprächtig oder beschissen bezeichnet wurde. Die Denkweise ist nicht neu, entweder ich habe es mit einer kreativen Lösung zu tun oder eben nicht. Was soll sich da entscheidend ändern oder geändert haben? Bezahlt werde ich auf Dauer für die Akzeptanz meiner Berufsausübung, übrigens eine reine Werkleistung, keine Kunst!
Welche Rolle meinen Sie, wird die Typografie in der Zukunft spielen?
Typografie ist die Basis jeglichen Graphic Designs. Das sagte Herb Lubalin, und obwohl er längst tot ist, hat dieses Zitat nach wie vor seine Gültigkeit. Und solange Menschen das Alphabet kennen, es gelernt haben, werden sie, um an Information zu kommen, lesen müssen. Dies geschieht durch Buchstaben, in unseren Gefilden 26 an der Zahl, die, miteinander kombiniert, zu Worten und zu ganzen Sätzen, zu ganzen Kolumnen, zu ganzen Büchern werden. Den oder die Menschen werden wir nicht ändern (können). Was 2000 Jahre mit und durch Schrift vermittelt wurde, ist für und in der Zukunft unumkehrbar.
EPILOG zum Beitrag „Zur Typografie und ihren Ursprüngen“, 29.August 2025.
Es bleibt die Frage, WAS ist zwischenzeitlich aus dem Type Directors Club of New York geworden?1946 gegründet bis in die heutigen Tage? Nun, viele, die meisten, der damaligen im Dunstkreis der an der Madison Avenue residierenden Agenturen mit ihren Type Directors sind längst nicht mehr. Die damalige eingebrachte Substanz an Wissen und Vision istl ängst aufgebraucht. 2022 wurde der TDC ein weiterer Bestandteil einer übergeordneten Institution „ The One Club for Creativity“ - gleichfalls findet man hier den Art Directors Club of New York. Man veranstaltet Wettbewerbe und schickt das Ergebnis around the world.Man sollte sich nicht an dem Titel des TDC-Jahrbuchs stören „The World´s Best Typography“ - sie ist es nicht, mit „contemporary“bezeichnet wäre es ehrlicher. Wo aber Substanz im Schwinden ist, ist eine Integrität - auch nicht mit Worthülsen - schwer aufrecht zu erhalten. Dem TDC und dem ADC geht es nicht anders, wie vielen, einst stolzen Gründungen. Sie fallen anscheinend unter ein natürliches Verblüheneinstmaliger prächtiger Blütenträume.

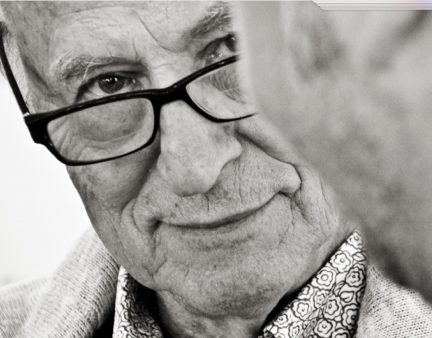
Schreibe einen Kommentar