Kommunikation als Dienstleistung am Beispiel einer Stadt
Öffentliche vs. Kommerzielle Kommunikation
Wenn wir über öffentliches Design, Kommunikation oder Markenarbeit sprechen, müssen wir zunächst einmal klar zwischen öffentlichen Institutionen und kommerziellen Unternehmen unterscheiden. Eine öffentliche Institution muss weder Gewinn erwirtschaften noch einem Aktionariat Rechenschaft ablegen. Eine Stadtverwaltung beispielsweise hat die Aufgabe, das öffentliche Leben in einer Stadt zu organisieren, zu gestalten und zu verwalten – und zwar so, dass die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich erfüllt werden. Dies betrifft folgende Bereiche: Verwaltung und Ordnung, Infrastruktur und Stadtentwicklung, Bildung, Kultur und Soziales, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Finanzen und Wirtschaft. Die Stadt ist gegenüber zahlreichen Zielgruppen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen verantwortlich und muss, insbesondere in einer direkten Demokratie wie in der Schweiz, ihre Arbeit gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern, Bürgerinnen und Bürgern sowie Stimmberechtigten argumentieren und rechtfertigen. Es geht dabei nicht um Marketing, sondern um die Ausrichtung der Kommunikation als Dienstleistung.
Gemeindefusionen als Verbesserung des Service Public
Um die Jahrtausendwende fand in der Schweiz eine breite Diskussion über die Effizienz der öffentlichen Verwaltung statt. Diese Auseinandersetzung führte unter anderem dazu, dass zahlreiche Gemeindezusammenschlüsse beschlossen wurden. Da es sehr viele sehr kleine Gemeinden gibt, lag es auf der Hand, das Potenzial der Rationalisierung durch den Zusammenschluss (economy of scale) von zwei oder mehreren Gemeinden zu nutzen. Eine der grössten Fusionen war die der Stadt Rapperswil mit der Gemeinde Jona am oberen Zürichsee, wodurch die zweitgrösste Stadt des Kantons St. Gallen entstand. Nachdem die Bürger den Zusammenschluss in einer Volksabstimmung im Jahr 2003 gutgeheissen und 2005 auch den Fusionsvertrag verabschiedet hatten, konnte das komplexe Projekt initiiert werden. Am 1. Januar 2007 fand schliesslich die offizielle Vereinigung statt.
Ein Erscheinungsbild für eine Stadtfusion
Um die Vereinigung umzusetzen, koordinierte ein aus Vertretern der beiden Gemeinden bestehender Lenkungsausschuss acht Schlüsselprojekte und neun Teilprojekte. Die Entwicklung des neuen Erscheinungsbilds war eines dieser Schlüsselprojekte. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung beurteilte eine externe Arbeitsgruppe aus Fachleuten für Gestaltung und Kommunikation mehr als 30 Bewerbungen. Den Zuschlag erhielt unser Studio Coande, Communication and Design.
Die Arbeiten zur Entwicklung des Erscheinungsbildes der Stadt Rapperswil-Jona begannen Anfang 2006 mit dem Ziel, dem neugewählten Stadtrat, der erstmals im Juli tagte, das fertige Konzept zur Genehmigung vorzulegen. Da der Stadtrat jedoch erst gewählt werden musste, wurde die Entwicklungsarbeit durch den Lenkungsausschuss begleitet. In einem intensiven gemeinsamen Projekt wurden die verschiedenen Aspekte des neuen Auftritts Schritt für Schritt besprochen und entschieden.
Die Entwicklung der Grundlagen
Die Entwicklung eines kohärenten und stimmigen Erscheinungsbilds basiert auf einer klaren Zielsetzung und klaren Wertvorstellungen. Diese werden dann durch die unterschiedlichen gestalterischen Elemente nachvollziehbar visualisiert. In Workshops wurden die kommunikativen Ziele des Projekts definiert und wie folgt beschrieben: «Durch den Zusammenschluss der Stadt Rapperswil und der Gemeinde Jona entsteht die neue Stadt Rapperswil-Jona. Diese Fusion bringt vorerst hauptsächlich im administrativen Bereich Veränderungen mit sich. Die neu entstehenden Synergien und Möglichkeiten sind Potenziale, die sich den Bürgerinnen und Bürgern sowie den weiteren Nutzerinnen und Nutzern der Stadt erst mit der Zeit erschliessen werden. Das bedeutet, dass sich die Identifikation mit der «neuen Stadt» erst bilden muss.» Die Grundsätze wurden wie folgt charakterisiert:
– Die Leistungen der Stadt sichtbar machen und nachvollziehbar vermitteln
– Die Verwaltung transparent darstellen
– Die Vielfältigkeit und Zukunftsfähigkeit der Stadt kommunizieren
– Die Präsenz der Institution Stadt auf dem Stadtgebiet markieren
– Durch aktive Kommunikation Goodwill, Sympathie und Stolz erzeugen
– Durch Systemdenken rationalisieren
Dazu kommt ein zusätzliches Bedürfnis, das die Gestaltung betrifft, nämlich die Dynamik der Stadt zu unterstreichen: Wir wollen eine farbige, lebendige Stadt

Eine weitere, wichtige Komponente im Entwicklungsprozess war die Auseinandersetzung mit den grundlegenden Elementen eines öffentlichen Auftritts. Betrachtet man das kommunikative Umfeld, in dem sich die Botschaften einer Gemeinde oder Stadt behaupten müssen, so wird schnell deutlich, dass die kommerzielle Kommunikation den Alltag dominiert. Das bedeutet, dass sich eine Stadt nicht über Quantität, sondern nur durch Eigenständigkeit, Konsequenz und Qualität durchsetzen kann. Für die Entwicklung des Erscheinungsbildes bedeutet dies, eine visuelle Sprache zu finden, die sich durch Originalität, Angemessenheit und Klarheit vom kommerziellen Umfeld abhebt. Dies beinhaltet auch, Techniken und Systeme zu vermeiden, die allgemein in der kommerziellen Kommunikation eingesetzt werden.
Die Markenarchitektur
Ein wichtiger Eckpfeiler des neuen Auftritts ist die Markenarchitektur. Als operatives Instrument zur Markensteuerung konzipiert, entspricht sie dem Grundsatz der Transparenz. Insbesondere ist sie so angelegt, dass alle Leistungen der Stadt erfasst und kategorisiert werden können. Jedes Medium und jede Mitteilung verfügen über eine klare Absenderkennzeichnung, sodass der Betrachter den Absender dieser Information identifizieren kann. Wo immer möglich, wird eine verantwortliche Person mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben. Die Markenarchitektur ist eine Navigationsform, mit der sich jede kommunikative Massnahme eindeutig der öffentlichen Hand zuordnen lässt. So wird erkennbar, ob eine Leistung direkt oder indirekt erbracht wird und welche organisatorischen Zusammenhänge vorliegen.

Das Designsystem
Die vielfältigen Aufgaben und Leistungen einer Stadt umfassen unterschiedlichste Themen und Botschaften – von Steuern und Kultur über Strassenbau und Bildung bis hin zu Kindergärten und Sportclubs. Diese Themen brauchen Raum. Nur so können sie individuell dargestellt werden. Das Erscheinungsbild ist daher als offenes System angelegt, das klare Regeln für die Kennzeichnung vorgibt, aber gleichzeitig einen grossen Spielraum für die Ausformulierung der einzelnen Botschaften zulässt. Um die Aspekte Offenheit, Optimismus und Ausrichtung auf die Zukunft darzustellen, wurden 15 vielseitig einsetzbare Farbtöne ausgewählt, die die Farbigkeit von Rapperswil-Jona unterstreichen. Es war nicht die Absicht, eine rote oder grüne Stadt zu vermitteln, sondern eine bunte. Die Farben werden bewusst als atmosphärisches Element eingesetzt.

Die Einführung und Umsetzung
Sowohl die Entwicklung als auch die Einführung wurden sehr sorgfältig angegangen. Im Vorfeld wurden verschiedene Institutionen, darunter Quartiervereine, politische Parteien und weitere Interessengruppen, durch Workshops in die Entwicklung einbezogen. In einer Ausstellung wurde zudem das Thema «Erscheinungsbild» und die wesentlichen Aspekte des Entwicklungsprozesses einem breiten Publikum vorgestellt und erläutert. Im Juli 2006 kam der neu gewählte Stadtrat zu seiner ersten Sitzung zusammen, um den neuen Auftritt zu verabschieden. Zur Einführung wurde zunächst eine Präsentation für alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung organisiert und am darauffolgenden Tag die Medien informiert. Anlässlich des Sommernachtfestes wurde der neue Auftritt der breiten Bevölkerung präsentiert.
Das neue Erscheinungsbild der Stadt Rapperswil-Jona wurde von Mitarbeitenden, Bevölkerung, Medien und Fachwelt positiv aufgenommen. In den wichtigsten Medien wurde der neue Auftritt diskutiert und äusserst positiv bewertet. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb beispielsweise am 10. August 2006: «Klares Erscheinungsbild für Rapperswil-Jona: Das neue Logo der Stadt Rapperswil-Jona hat das Zeug zum Klassiker. Mit den elegant zu einem Monogramm verschlungenen Buchstaben R und J präsentiert sich Rapperswil-Jona als vielfältige, moderne und sympathische Stadt.» Der Auftritt wurde auch in Ausstellungen zu Schweizer Design in Japan und Korea präsentiert, für den Designpreis Schweiz nominiert und 2020 in die Hall of Fame des Schweizer Designs aufgenommen.

Das Erscheinungsbild aus heutiger Sicht
Das Erscheinungsbild von Rapperswil-Joan existiert seit 18 Jahren und wird nach wie vor – abgesehen von einigen Anpassungen, vor allem im Bereich Social Media – basierend auf den ursprünglichen Grundlagen weiterverwendet. Das spricht für die Qualität der Arbeit und beweist, dass sich eine intensive, vertiefte konzeptionelle Grundlagenentwicklung auszahlt. Dies ist auch der aktiven Einbindung aller betroffenen Fachkräfte der Stadtverwaltung in der Entwicklungs- und Umsetzungsphase zu verdanken. So entstand eine echte interne Kultur der Information und Kommunikation. Dabei war es entscheidend, dass die verantwortlichen Personen in der Verwaltung diese pflegen und auch von den Mitarbeitenden einfordern.
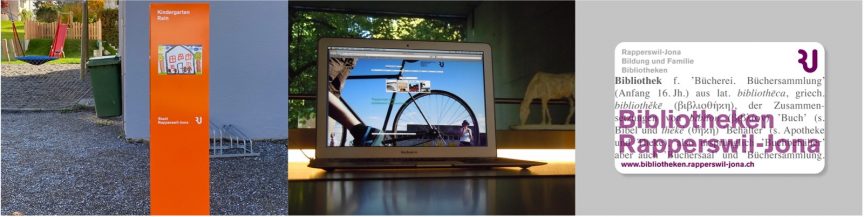
Auch die Tatsache, dass das Stadtpräsidium in dieser Zeit viermal gewechselt hat, zeugt von einem breiten Konsens und der ausserordentlichen Qualität des Projekts. (Eine Studie von Tony Spaeht zeigt, dass in den USA in 64 % aller Fälle das Logo geändert wird, nachdem ein CEO gewechselt hat.) Die fast zwanzig Jahre, in denen das Erscheinungsbild von Rapperswil-Jona geprägt wurde, zeigen, dass sich sorgfältige Arbeit und laufende Pflege lohnen. Die langjährige Anwendung beweist, dass die entwickelten Grundlagen und Werte dazu führten, die Kommunikation der Stadt als effektive Dienstleistung zu etablieren.

