Alles Corporate, oder was?
Kommentar des Editor-in-Chief | Johannes Frederik Christensen
The Business of Brand Management beleuchtet Markenführung im Kontext von Gegenwart und Geschichte. Dieser Beitrag ist Teil einer Reihe von Wiederveröffentlichungen ausgewählter Texte von Olaf Leu und Bodo Rieger aus den Jahren 1987 bis 2018. Was damals gedacht, geschrieben und vertreten wurde, lohnt die erneute Lektüre – nicht aus Nostalgie, sondern weil sich darin Fragen spiegeln, die auch heute nicht gelöst sind.
Das Infomagazin „BluePrint“ von wirDesign, Braunschweig/Berlin, stellte in einer Ausgabe einige Fragen zum Corporate Design und betitelte das Ganze mit der fragenden Überschrift:
„Ist Corporate Design tot?
Zumindest aus den Headlines und Diskussionen der Marketing- und Communications-Community ist es fast verschwunden. Content, Storytelling, Onlinestrategien, das sind einige der neuen Helden. Ist das Prinzip Corporate Design nur noch ‚old school‘? Ist es bei der medialen Vielfalt überhaupt noch zu händeln? Und wie verändert die Vielzahl der neuen Medien das Prinzip? Ist Corporate Design einengende Zwangsjacke oder hilfreiche Leitplanke? Schafft es einen Mehrwert?“
Nun, das alles sind durchaus berechtigte Fragen. Aber ich denke, Corporate Design ist nicht tot. Schließlich führt inzwischen jede noch so winzige oder auch bedeutende Kommunikationsschneiderei „Corporate Design“ in ihrem Portfolio. Dahinter verbirgt sich der verkappte Wunsch, nicht nur ein kleines Stück von der Torte abzusahnen, sondern möglichst von der ganzen zu profitieren. Es handelt sich hier also mehr um eine wortgewaltige Erweiterung der Geschäftsidee als zwingend um ein kommunikativ-intelligentes Anliegen. Zumal auch der Begriff „Corporate“ so schön, so allumfassend, so bedeutend klingt. Schwuppdiwupp steht es im breit gefächerten Angebot.
Doch weil sich inzwischen jede Kreativbude mit „Corporate Design“ brüstet, verfällt die Branche nun in den nächsten, sicher auch im Inflationären endenden Rausch und räumt der „Marke“ eine absolute Vorrangstellung ein. Alles ist jetzt Marke. Alles wird zur Marke. Oder soll und muss dazu werden.
Das wiederum führt unweigerlich zu einem neuen Begriff, dem der „Markenidentität“.
Klingt auch bedeutend, wobei „Corporate Identity“ eigentlich dasselbe meint, aber längst ausgelutscht ist.
Die Industrie und Wirtschaft zeigt sich in diesen Dingen sehr ambivalent.
Beispiel Deutsche Bank: Mit 7000 Prozessen belastet und einem schnöden Aktienkurs sehen die Aktionäre und explizit der Aufsichtsratsvorsitzende den nach wie vor eingesetzten handgeschriebenen Slogan „Leistung aus Leidenschaft“ inzwischen sehr kritisch: „Niemand kann mit dem äußeren Erscheinungsbild sowie mit der Entwicklung des Aktienkurses zufrieden sein“, so der Aufsichtsratsvorsitzende im Mai 2015.
Eigentlich müsste die Weiterverwendung des Slogans nach diesem Kommentar doch obsolet sein. Aber nichts dergleichen passiert. Ich hätte den Herren der Deutschen Bank schon längst zur Ablösung dieses Slogans geraten. Denn: Lieber keinen Slogan als diesen „konterkarierenden“.
Übrigens sind sie mir bei diversen Wettbewerbsveranstaltungen, bei denen es um Geschäftsberichte ging, stets als präsente Teilnehmer aufgefallen, die höflichen und freundlichen Abgesandten der Abteilung Investor Relations der Deutschen Bank. Aber nie habe ich sichtbare Auswirkungen dieser Besuche erlebt. Nie habe ich gesehen, dass sich etwas bewegt. Immer war der Geschäftsbericht der Deutschen Bank im unteren Bereich der Rankings zu finden. Mein Fazit: Es handelt sich hier um eine selbstherrliche Resistenz gegenüber jeglicher Veränderung. Anders ist diese stetige Präsenz der Abgesandten nicht zu erklären. Vielleicht waren sie aber auch nur froh und benutzten jede sich bietende Gelegenheit, der Burg und ihren „Leidenschaftlich Leistenden“ zu entfliehen. Aber das ist nur eine Vermutung.
Jedenfalls fand ich kürzlich auf der rückseitigen Scheibe eines nagelneuen Fiat-Panda folgenden Slogan: „Lieber mit dem Fiat zum Strand als mit dem Mercedes zur Arbeit.“
Das ist das exakte Gegenteil von „Leistung mit Leidenschaft“. Hier eine Karikatur, dort ein Schmunzeln.
Folgen wir also dem Trend „zur Marke“. Dazu gibt es eine interessante Einlassung von Uli Mayer-Johannson, die lange Jahre CEO von MetaDesign in Berlin war.
Sie schreibt: „Mittlerweile ist alles Marke und gleichzeitig führt es dazu, dass keine eindeutige
Zuschreibung mehr gelingen mag. Je mehr wir darunter subsumieren, desto unschärfer,
flimmernder und nichtssagender scheint der Begriff zu werden. Und so werden die Fragen zum
Thema Marke und das Ringen um Klarheit uns wohl lange begleiten.“
Total Identity, das kreative Beratungsbüro aus Amsterdam, das sich mit Identitätsfragen beschäftigt, hat in der 2008 erschienenen Buchpublikation „Identity 2.0“ Gedanken über Organisationen aller Art in ihrem Kontext, insbesondere auch in Bezug auf Marken gesammelt:
„‚Das Markendenken‘ beruht auf der Ansicht, dass Marken primär als Anhäufung von Werten und Kommunikationskanälen zum Markt gedacht sind, die die größtmögliche Kongruenz zwischen den Markenwerten und dem Wertesystem der Zielgruppe aufweisen. Marken symbolisieren die Einstellungen von Verbrauchern, den Lebensstil, den diese anstreben, und die sozioökonomische Klasse, welcher sie angehören. Das ist das die zentrale These des ‚Branding‘.
Diese Symbolfunktion von Marken verliert an Bedeutung. Die Verwendung der Marke als Symbol für die gesellschaftliche Position, die ein Individuum einnimmt, wird von einem Prozess der gesellschaftlichen Angleichung untergraben. Ironischerweise dienen Statusmarken wie Armani oder Ray-Ban nur noch in den wirtschaftlichen Unterschichten als Symbole des gesellschaftlichen Status. (...) Je mehr wir über die Unternehmen hinter der Marke erfahren, desto schaler wird oftmals der Inhalt der Werbung für ihre Marken, und desto größer wird unsere Irritation angesichts der Exzesse dieser Werbung. Es ist deshalb keine Überraschung, dass diejenigen, die die Diskrepanz zwischen dem Verhalten der Eltern hinter der Marke und der Marke selbst offenlegen, auf teils erhebliche Resonanz in der Gesellschaft stoßen. (...) Schließlich verändert sich auch die Einstellung des Individuums zu Marken und den Unternehmen dahinter. Bis Mitte der 90er-Jahre gab es kaum Interesse für das Unternehmen hinter der Marke. Heutzutage wollen die Verbraucher in der Lage sein, sich mit Unternehmen zu identifizieren, deren Produkte und Dienstleistungen sie kaufen, und nicht mit den abstrakten Symbolen und dem Lebensstil, die in der Werbung für diese Marken vermittelt werden. (...) Im Gegensatz zum ‚Markendenken‘, bei dem es darauf ankommt, sich so schnell und so deutlich wie möglich von anderen Marken zu unterscheiden, diesen Unterschied zu kommunizieren und so die Wertschätzung der Verbraucher zu gewinnen – liegt der Schwerpunkt des Identitätsdenkens darin, Transparenz im Denken und Handeln des Unternehmens zu etablieren.“
Worum geht es eigentlich bei all den hier behandelten Problemstellungen und verschiedenen Begriffen? Es geht doch nicht nur um mögliche „Auftragsgrößen“, hier ein Corporate Design, dort eine zu konkretisierende Identity. Und es geht auch nicht um die kurzfristigen Etablierung einer „Marke“ – derzeit übrigens Mainstream und wiederzufinden unter „Markenidentität“.
Nein, es geht um nicht mehr und nicht weniger als um das „alte“ Ziel der Unternehmensidentität.
Diese mitzugestalten, dazu bedarf es allerdings eines umfassenden und neu auszurichtenden Denkens.
Und zwar von beiden Seiten – von Auftraggebern und Auftragnehmern. Was die Designer betrifft, so setzt diese Forderung zweifellos auch eine grundlegende Neuausrichtung der entsprechenden Studiengänge voraus. Und auf der Auftraggeberseite? Hier muss klar werden, dass man über einen Pitch nicht die passende Agentur mit der dafür notwendigen Manpower rekrutieren kann.
Dazu bemerkt der renommierte Schweizer Designer Peter Vetter in seinem Buch über „Design als Unternehmensstrategie“ unter der Überschrift „Designer-Casting oder über die Unsitte der Pitchs“:
„In den letzten Jahren wurde aus den USA die Idee der Pitchs importiert, und ein Pitch ist nun fast die übliche Ausschreibungsform der Branche. Bei einem Pitch werden verschiedene infrage kommende Teams eingeladen, ihre Lösungsvorschläge – basierend auf einem definierten Briefing – für ein Projekt zu entwickeln und zu präsentieren. Die dafür zur Verfügung gestellten Honorare decken in der Regel die Aufwendungen in keiner Weise ab, sondern sind eher eine Art Spesenvergütung. Der Dialog zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer reduziert sich meist auf eine Fragestunde oder ähnliche Kontakte. In der Regel wird und will der Auftraggeber in dieser ersten Phase nicht in der notwendigen Tiefe in den Prozess eingreifen. Ziel eines Pitchs oder einer Wettbewerbspräsentation ist es vielmehr, über unterschiedliche Teilnehmer ein breites und differenziertes Spektrum an möglichen Lösungen zu erhalten. Ob das wirklich so ist, sei einmal dahingestellt. Dass ein solches Vorgehen zu effektiver Innovation führt, ist aber sicher fraglich.“
Meist sind die Ergebnisse von Pitchs vergleichbar mit dem Griff in eine Knopfkiste. Denn
eine vorausgehende, dem Unternehmen angemessene Analyse von vorhandenen und eventuell
neu zu gestaltenden Faktoren, findet bei den Auftrag nehmenden Büros und Agenturen eigentlich nie statt. Zum einen aufgrund der mangelhaften oder aber nicht vorhandenen Einblicke in das zu bearbeitende Geschäftsfeld und zum anderen verursacht durch eine nicht vorhandene bzw. unangemessene Honorierung.
Klar, dass es die mit „Groß-Aufträgen“ geköderten Pitch-Teilnehmer deshalb mit dem „Aufhübschen“ von Vorhandenem versuchen, auch in der Hoffnung, „ein passender Knopf“ könnte schon dabei sein.
Doch wenn überhaupt zu einer Unternehmensidentität beigetragen werden kann, dann kann dies nur
in präzise zu erarbeitenden und sehr konsequent einzuhaltenden fünf Phasen gelingen:
1. Analyse, 2. Hypothese, 3. Synthese, 4. Umsetzung und 5. laufende Bearbeitung.
Dieser Aufwand ist – zeitlich und finanziell – allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn sich beide Teile,
Unternehmen und Gestalter, ihrer Sache sicher sind. Das ist ein Entwicklungsprozess und nicht etwa eine aktionistische „Miss-Beauty-Wahl“ wie man sie derzeit als „Pitch“ veranstaltet.
Das gegenwärtige, daraus erwachsene Unwohlsein der Kreativen gegenüber den Auftraggebern spiegelt sich zunehmend auch in den Kommentaren „schreibender“, ich nenne sie „denkender“ Kollegen wider.
So findet man in Uli Mayer-Johannsen’s kleinem Marken-Buch folgende „Einblicke“:
„Shigeo Haruyama, ein berühmter japanischer Arzt, bringt es auf den Punkt: ‚Das Maß entscheidet, ob etwas zum Heilmittel oder zum Gift wird‘. Ganz offensichtlich ist Maßhalten in dem, was und wie wir es tun, eine der großen Herausforderungen unserer Zeit.
Wirtschaft und Politik haben sich ins Sparen verliebt. Die Controller auf der einen Seite und die politischen Mahner auf der anderen Seite. Je lauter der Ruf der Analysten nach Quartalszahlen wird und je mehr Vorstände sich davon unter Druck setzen lassen, desto mehr erodiert das, woraus Unternehmen Kraft und Zukunftskapital schöpfen. Die ‚Ressource’ Mensch strauchelt unter der Last des unermüdlichen Ringens um Effektivität und stellt zunehmend die Sinnfrage.
Die weichen Faktoren, zu denen immer noch Mensch, Marke und Kommunikation zählen, werden meist zuerst den unbegrenzten Einsparmöglichkeiten geopfert. Leider bleibt das nicht ohne Folgen. Marken und ihr mühsam aufgebautes Markenkapital haben eine äußerst geringe ‚Halbwertzeit‘. Die Mahnungen vieler Kommunikations- wie Marketingverantwortlichen bleiben allzu oft ungehört und zerschellen im Börsengewitter der Algorithmen, die begierig nach immer mehr in immer kürzerer Zeit verlangen. (...) Kontinuität ist in der Markenführung mittlerweile ein rares Gut geworden. Steigender Wettbewerbsdruck und ein unerbittlicher Kampf um Marktanteile haben dazu geführt, dass viele Unternehmen immer kurzfristiger und taktischer agieren. Man schraubt an vielen kleinen Baustellen, versucht Probleme mit technischen Spielereien oder schnellen PoS-Aktionen zu lösen. Dabei geht jedoch zu oft die Sicht auf das große Ganze und die Wirkungsdimensionen für Unternehmen und Marke verloren. ...Schuld an dieser Entwicklung sind auch die häufigen Wechsel der Marketingverantwortlichen, die zu immer neuen, kurzfristigeren Strategien und Werbekonzepten führen.“
In ihrem Begleitbrief zu dem zitierten Marken-Buch schrieb mir Uli Mayer-Johannsen:
„Nicht erst das Jahr 2014 hat unter Beweis gestellt, dass wegen des rasanten Wandels unsere Anpassungsfähigkeit wohl noch nie so gefragt war wie heute. Eine Welt im Strudel des Wandels, die Gesellschaft und Wirtschaft immer wieder aufs Neue fordert und nicht selten überfordert. Der Mensch scheint aus dem Blick zu geraten. Effizienz und Zahlen scheinen die allein glücklich machenden ökonomischen Parameter. Und so trudeln wir in eine Effizienzgesellschaft, die langfristig dem Menschen und der Gesellschaft schadet.
Denn bei allem Wandel und allen faszinierenden technologischen Errungenschaften bleiben die Menschen und ihre Bedürfnisse zunehmend auf der Strecke. Vision, Idee, Identität, Werte und Mitarbeiterbegeisterung sind aus dem Blick geraten.“
Einen wesentlichen Ansatz zu einer Neubetrachtung liefert Total Identity. In ihrem lesenswerten Buch „Identity 2.0“ heißt es hier unter der Überschrift ‚Ethik. Die Jahre nach 2000‘: Balancen.
„Identität hält nicht ewig, weder als Ausgangspunkt für die Kommunikation eines Unternehmens noch als Weg, gesellschaftliche Akzeptanz zu erlangen. Jetzt wird offenbar, dass Identität wirklich in Gefahr ist, bis zu dem Punkt zu verkommen, an dem sie eine Konstruktion ohne Inhalt, lediglich als leere Hülle für einen Verkaufstrick eingesetzt wird. Die Öffentlichkeit lernt aus ihren Erfahrungen mit der Marke und ist unzufrieden, wenn Identität als Instrument für das Image formuliert wird. Gleichzeitig wird die Gesellschaft immer anonymer. Der Wohlfahrtsstaat wird abgebaut, und wir müssen uns immer mehr auf uns selbst verlassen. Medien wie das Internet, UMTS oder Mobiltelefone beschleunigen den Informationsfluss und haben persönliche Beziehungen oberflächlicher werden lassen. Wechselbeziehungen werden seltener zur Norm. Wir umkreisen einander mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und doch suchen wir ernsthaft eine Möglichkeit, miteinander in Verbindung zu bleiben, nachdem der persönliche Kontakt nun kein automatischer und strukturierter Vorgang mehr ist. Diese Fragmentierung der Gesellschaft wird einen immer stärkeren Bedarf an dedizierten Formen der Standardisierung mit sich bringen: sozial und kulturell akzeptierte Standards, die erforderlich sind, einer zunehmend dynamischen Gesellschaft eine zielorientierte Richtung zu verleihen. Durch gemeinsame Werte schaffen wir neue Verbindungsmöglichkeiten, die nicht auf unsere gesellschaftlichen Beziehungen begrenzt sind. Dies gilt auch für die Wirtschaft. Die Werte, die wir bestimmen, um unserem Leben eine Richtung zu geben (unsere Integrität), werden auch von Unternehmen und der Regierung verlangt. Die Wirtschaft ist Gesellschaft und umgekehrt. Und Unternehmensverantwortung sowie gute Unternehmensführung (Corporate Governance) werden zur ethischen Basis des Handelns. (…)
Selbstbewusste Unternehmen bestimmen die Themen selbst, zu denen sie eine Meinung haben. Und sie bestimmen die Art und Weise, wie sie diese äußern. Sie beziehen Stellung gegenüber Geschehnissen in der Gesellschaft und auf dem Markt und beanspruchen damit einen bestimmten Platz auf dem Spielfeld der Zielgruppen, Aktionäre und anderer Beteiligter. Diese Gruppen wissen wiederum, was sie von dem Unternehmen erwarten können, und finden es in dessen Verhalten, Kommunikation und Symbolik bestätigt. Diese drei Elemente der Identität sind voneinander untrennbar und verstärken sich einander. Das Unternehmen präsentiert sich deutlich über diese Aspekte und legt damit den Grundstein für Vertrauen und Respekt. Kommunikation, Verhalten und Symbolik erhalten auf der Grundlage von Identität neue Bedeutung. Der Schwerpunkt hat sich in Richtung ‚Emotion‘ verschoben, auf Identifikation statt Imponiergehabe, hin zum Engagement statt zur Profilierung, zur Entwicklung einer nachhaltigen Beziehung, statt Impulsen nachzugeben.
Dieser neue Ansatz setzt bei Unternehmen eine andere Einstellung voraus. Er verlangt nach mehr Empathie, die sich von der paternalistischen, herablassenden und wahrnehmungsorientierten Haltung unterscheidet, die gemeinhin mit Unternehmen assoziiert wird.“
Ich habe alle zitierten Beiträge aus nur einem Grund ausgewählt: Weil sie unmissverständlich die Erfordernisse eines neuen Denkens einfordern. An erster Stelle sind hier die Unternehmen und ihr Führungspersonal genannt und gefragt. Nur wenige von ihnen haben die Zeichen der kommunikativen Zukunft erkannt – die meisten müssen um-denken, jetzt.
Denn es muss Schluss sein mit dem derzeitigen Usus, dass bei Pitchs um Geschäftsberichte oder andere Projekte schon im Vorfeld „kreative Vorschläge“ erwartet werden! Schließlich können solche Vorschläge allenfalls der (nicht oder nur mäßig honorierten) Phantasie der Teilnehmer entstammen – sie entsprechen nie der vom Auftraggeber erwarteten Unternehmensrealität.
Gerade am gedruckten Medium Geschäftsbericht kann man grundlegend feststellen, wie konsequent oder inkonsequent ein Unternehmen sein „visuelles Bild“ pflegt, verteidigt oder es dem freien Spiel der Kräfte und der Zeiten überlässt.
Es ist deshalb nur zu hoffen, dass wir in diesem Bereich wieder zur Ernst- und Sinnhaftigkeit zurückkehren. Denn anders sind die Herausforderungen, denen sich die Kommunikationsbranche zukünftig mehr denn je stellen muss, nicht zu meistern.
EPILOG zu "Alles Corporate, oder was?", 11.08.2025
Paul Rand, 1914-1996, gilt als „Vater der modernen Designbranche". Er verwandelte Grafikdesign von einem weitgehend kunstbasierten Handwerk in das leistungsstarke Instrument der Unternehmenskommunikation, das wir heute kennen. Verantwortlich für Marken wie IBM, NEXT, WESTINGHOUSE, UPS. Er äusserte sich schon am Ende der Neunziger Jahre in einem Artikel, in dem er vieles von dem, was für Design gehalten wurde, als „Graffiti“ bezeichnet: ..eine Collage von Verwirrung und Chaos zwischen High Tech und niedrigem künstlerischem Wert schwankend, verpackt im Mantel der Arroganz, Schnörkel, Strichmännchen, Klötzchen, Boudoir-Farben, was immer ein Computer an Spezialeffekten zu bieten hat". Diese Dekorationen sind offenbar ein bequemer Ersatz für wirkliche Ideen und wirkliches Können ..., was würde „er“ heute, 29 Jahre später sagen?

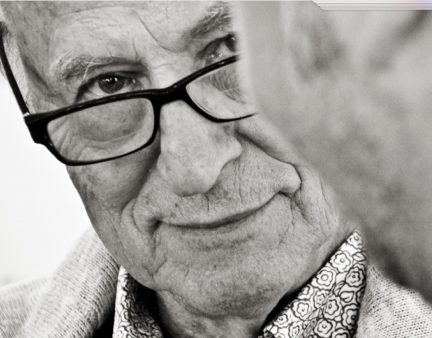
Schreibe einen Kommentar